
Der Deal, der nie zustande kam: Washington schlug vor, Moskau stimmte zu – und Trump blockierte ihn
Der Deal, der nie zustande kam offenbart, wie Trumps transaktionale Diplomatie – von Seoul bis Anchorage – aus einer greifbaren Friedensmöglichkeit eine verpasste Chance machte.
Der vorgeschlagene Plan – etwas in der Art eines ‚Istanbul Plus‘ – wurde von Washington formuliert und dann abrupt fallengelassen. Von Lawrows aufschlussreichem Interview, das wir unten besprechen, bis zum Zusammenbruch des Alaska-Gipfels zeigt dieses Ereignis, wie ein von den USA initiierter Waffenstillstandsplan in der Ukraine scheiterte, Russland skeptisch zurückließ, die diplomatischen Kanäle einfrieren ließ und die militärischen Spannungen eskalieren ließ.
Eine einmalige Gelegenheit, die den Kriegsverlauf hätte verändern und Washingtons internationale Glaubwürdigkeit hätte stärken können, blieb ungenutzt – ein Lehrstück darüber, wie kurzfristige politische Kalküle langfristige Friedenschancen zerstören können.
Trumps Muster der transaktionalen Diplomatie
Präsident Donald Trump besuchte kürzlich Südkorea, wo er zeremonielle Ehren erhielt und ein neues Handelsabkommen verhandelte. Berichten zufolge stimmte Trump zu, die US-Zölle auf südkoreanische Exporte zu senken, im Austausch für Südkoreas Zusage, etwa 350 Milliarden Dollar in die USA zu investieren.
Dieser Deal illustriert Trumps typische Taktik: Er setzt erdrückende Zölle ein, erzwingt gigantische Investitionszusagen – und rollt die Zölle anschließend wieder zurück. Dieselbe Taktik wendete er bei der EU, Japan und anderen an – während China standhaft blieb und zurückschlug. Der Ansatz wirkt weniger wie eine kohärente protektionistische Politik, sondern eher wie ein Schutzgelderpressungs-System der 1920er Jahre, eher an Mafia-Erpressungen erinnernd als an moderne Staatskunst. Viele zweifeln daran, dass die zugesagten Investitionen jemals realisiert werden, und der Oberste Gerichtshof der USA wird demnächst die Verfassungsmäßigkeit von Trumps Zollstrategie prüfen – von vielen als Zwangsdiplomatie und nicht als solide Wirtschaftspolitik betrachtet.
Dieses Vorgehen spiegelt Trumps Methoden auch in anderen Bereichen wider, insbesondere im Umgang mit Russland. Während des Gipfels in Anchorage schlug Trumps Gesandter einen Friedensplan für die Ukraine vor, den Moskau akzeptierte. Trump zog sich jedoch später zurück, stellte neue Forderungen, diffamierte Putin öffentlich und eskalierte die Spannungen durch Drohungen mit Sanktionen und Raketenstationierungen. Das Muster – Getöse, theatralisches Deal-Making und Rückzug – ist ein prägendes Merkmal seiner Außenpolitik geworden und hat die Glaubwürdigkeit der USA in den Augen vieler internationaler Beobachter stark geschwächt.
Der russische Analyst Dmitri Trenin schrieb in Kommersant, einer Zeitung, die in Russlands Wirtschaftskreisen weit gelesen wird, über Moskaus sich wandelnde Wahrnehmung Trumps und deutete an, dass bedeutsame Geschäftsbeziehungen zwischen Russland und den USA in absehbarer Zeit unwahrscheinlich sind. Seine Analyse porträtiert Präsident Trump als:
unberechenbar und manipulierend, zwischen Drohungen und Charme wechselnd;
getrieben von persönlicher Glorie statt konsistenter strategischer Vision;
wirtschaftlich räuberisch, Zölle und Handelskriege einsetzend, um Rivalen zu unterdrücken;
stärker auf Optik als auf Substanz bedacht, Foto-Waffenstillstände einem dauerhaften Frieden vorziehend.

Dmitri Trenin in Kommersant – Screenshot mit englischer Übersetzung aus dem Russischen
Trenin kommt zu dem Schluss, dass Russland keine bedeutenden Verhandlungen mit Trump mehr erwartet, nachdem die Grenzen seiner tatsächlichen Macht innerhalb des amerikanischen Systems, also des permanenten Deep State, erkannt wurden. Dennoch habe Moskaus Engagement mit Trump – die sogenannte „besondere diplomatische Operation“ – einen strategischen Zweck erfüllt: Es signalisierte wichtigen Partnern wie China, Indien und Brasilien, dass Russland zu Dialogen offen bleibe und, solange es keine westliche Einmischung oder Behinderung durch das banderistische Regime gebe, an einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts interessiert sei. Gleichzeitig beruhigte es die russische Öffentlichkeit über die Entschlossenheit ihrer Führung und verstärkte die Überzeugung, dass nur militärischer Erfolg – nicht US-vermittelte, zwanghafte „Diplomatie“ – Russlands langfristige Ziele in der Ukraine sichern könne.
Lavrovs Interview: Neue Einblicke in einen gescheiterten Friedensplan
In einem kürzlichen Interview mit einem ungarischen YouTube-Kanal – dem gleichen, der gelegentlich auch vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán genutzt wird – gab Russlands Außenminister Sergej Lawrow Einblicke in die diplomatischen Austausche zwischen den USA und Russland seit Mitte des Jahres. Seine Aussagen klärten mehrere Unsicherheiten rund um den Alaska-Gipfel und den abgesagten Budapest-Gipfel und boten einen seltenen Blick auf Verhandlungen, die den Kriegsverlauf hätten verändern können.
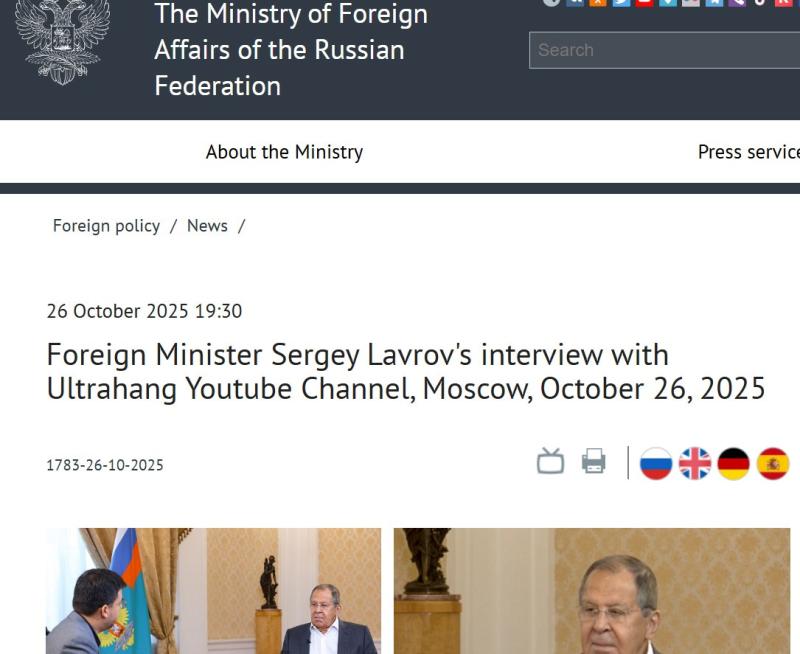
Der Alaska-Gipfel und der US-Vorschlag
Laut Lawrow reiste Präsident Wladimir Putin nach Alaska, nachdem ihm Tage zuvor ein von Trumps Gesandtem Steve Witkoff nach Moskau gebrachter Plan übermittelt worden war. Putin prüfte den US-Vorschlag im Detail, Witkoff war anwesend, und bestätigte, dass Moskau bereit war, ihn anzunehmen – obwohl der Plan vollständig amerikanischen Ursprungs war.
Der Vorschlag sah einen Waffenstillstand in den Regionen Saporischschja und Cherson im Austausch für den ukrainischen Rückzug aus dem Donbass vor. Im Gegensatz zu vielen westlichen Medienberichten handelte es sich hierbei nicht um eine russische Friedensinitiative, sondern um einen amerikanischen Vorschlag, zuerst von Washington formuliert und präsentiert.
Zusammenbruch des Deals
Putin erwartete Berichten zufolge, dass Trump die Vereinbarung während ihres Treffens in Alaska formell bestätigen würde. Stattdessen zögerte Trump, mit der Begründung, er müsse zunächst Verbündete und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj konsultieren.
Selenskyj und europäische Führungspersönlichkeiten lehnten sofort jegliche Vereinbarung ab, die einen ukrainischen Rückzug aus dem Donbass vorsah. Sie bestanden darauf, dass Kyivs NATO- und EU-Bestrebungen unverhandelbar bleiben und dass ein Waffenstillstand entlang der bestehenden Frontlinien erfolgen müsse.
Trumps Zögern – und sein Versäumnis, den Vorschlag seines Gesandten aufrechtzuerhalten – führten zum Scheitern des Deals. Das Kreml interpretierte diese Kehrtwende als weiteres Beispiel für amerikanische Unbeständigkeit und politische Schwäche und bekräftigte lang gehegte Zweifel an Washingtons Verlässlichkeit.
Strategische Kalkulationen und Fehleinschätzungen
Aus Washingtons Sicht glaubten die USA, dass Russland kurz davor war, den Donbass zu erobern, und sahen den Vorschlag als Möglichkeit, Hebelwirkung zu managen und eine diplomatische Ausstiegsmöglichkeit zu schaffen. Moskau hingegen betrachtete den amerikanischen Plan als Chance, territoriale Realitäten zu formalisieren und den Konflikt unter gegenseitig vereinbarten Bedingungen zu stabilisieren.
Als Trump scheiterte, kam Moskaus Analyse zum Schluss, dass das Fenster für Kompromisse sich schloss. Mit dem Fortschreiten russischer Militäraktionen nahm der Anreiz für Verhandlungen ab – künftige Ergebnisse würden somit eher auf dem Schlachtfeld als am Verhandlungstisch entschieden.
Historischer und territorialer Kontext
Lawrow bekräftigte erneut, dass Saporischschja – gegründet im Zarenreich unter Katharina der Großen – und Cherson historisch zum eigenen Staatsgebiet gehören. Ihre Eingliederung in die Ukraine sei, so Moskau, lediglich das Ergebnis sowjetischer Verwaltungsentscheidungen. Der Kreml ist inzwischen überzeugt, dass weder die USA noch westliche Garantien russische Interessen in diesen Regionen verlässlich schützen würden. Diese Wahrnehmung hat Russlands Haltung weiter verhärtet und die Bereitschaft, neue westliche Vorschläge zu prüfen, deutlich verringert.
US-russische Raketendynamik
Ein weiterer zentraler Punkt, der die Spannungen zwischen den USA und Russland definiert, betrifft Raketeneinsätze. Russland betrachtet Langstreckenraketen – darunter Systeme wie Tomahawk, Taurus und Storm Shadow – als rote Linien, deren Einsatz den Konflikt unkontrollierbar eskalieren lassen könnte.
Als Reaktion hat Moskau die Produktion seiner nuklearbetriebenen Marschflugkörper Burevestnik beschleunigt und die Stationierung hypersonischer Waffen ausgeweitet, die jedes europäische Ziel erreichen können. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Militarisierung gescheiterter Diplomatie – ein Übergang vom Verhandlungstisch zur Abschreckung durch militärische Macht.
Trumps Alaska-Risiko und seine Folgen
Trumps Umgang mit dem Alaska-Vorschlag wird in Moskau weithin als inkonsequent, unentschlossen und politisch naiv angesehen. Trotz der Initiierung des Vorschlags gelang es ihm nicht, ihn gegenüber Putin zu bestätigen, mit Verweis auf weitere Konsultationen. Gleichzeitig trat er parallel mit Chinas Präsident Xi Jinping in Kontakt, offenbar in der Annahme, sowohl Peking als auch Moskau gleichzeitig unter Druck setzen zu können.
Russische Beobachter werteten diese Schritte als strategisch inkohärent und beispielhaft für Trumps fehlerhaftes Verständnis globaler Machtverhältnisse. Trenin und andere Analysten argumentieren, dass dieses Ereignis das Vertrauen Moskaus in Washington dauerhaft beschädigt und die Volatilität US-amerikanischer Politik bei kurzfristigen inländischen oder persönlichen Interessen verdeutlicht.
Aktuelle Lage
Mit Russlands Konsolidierung der Kontrolle über Donbass und Südukraine sind die Aussichten auf einen US-vermittelten Kompromiss praktisch verschwunden. Russische Hardliner, durch das Scheitern des Alaska-Plans bestätigt, sind nun noch weniger verhandlungsbereit.
Die diplomatischen Kanäle zwischen Washington und Moskau bleiben minimal, während die militärischen Risiken – insbesondere im Hinblick auf mögliche Raketenkonfrontationen in Europa – steigen. Lawrow machte deutlich, dass Russlands rote Linien notfalls militärisch durchgesetzt werden.
Wichtige Erkenntnisse
Der Alaska-Waffenstillstandsplan wurde ursprünglich von den USA vorgeschlagen, nicht von Russland.
Der Plan scheiterte aufgrund US-amerikanischer Unentschlossenheit und der ukrainisch-europäischen Ablehnung territorialer Kompromisse.
Russland betrachtet Regionen wie Donbass, Saporischschja und Cherson als historisch legitime russische Gebiete.
Trumps transaktionaler Stil, sowohl in Südkorea als auch in Anchorage sichtbar, zeigt ein Muster coerciver, kurzfristiger Deal-Making-Strategien.
Moskaus Misstrauen gegenüber Washington hat sich vertieft; die USA werden als unzuverlässig, politisch fragmentiert und unfähig zu nachhaltiger Diplomatie wahrgenommen.
Diplomatie als Schutzgelderpressung
Trumps Außenpolitik vermischt zunehmend wirtschaftliche Einschüchterung mit diplomatischer Schau. Ob in Seoul oder Anchorage, das Muster bleibt gleich: massiver Druck, enorme Zusagen extrahieren, Erfolg reklamieren und weitermachen.
Doch diese Strategie – teils politisches Theater, teils Zwang – könnte sich letztlich rächen. Sollte Russland jemals die stenografischen Aufzeichnungen der Anchorage-Gespräche veröffentlichen, könnten sie Trump als doppeldeutig und schwach entlarven, was seine internationale Glaubwürdigkeit weiter untergräbt.
Der „Deal, der nie zustande kam“, steht nun als warnendes Beispiel: ein Moment, in dem persönliche Ambitionen und transaktionale Diplomatie strategische Weitsicht überschatteten. Er zeigt, wie das Streben nach kurzfristiger Optik langfristigen Frieden und die Diplomatie selbst untergraben kann.
«Der Deal, der nie zustande kam: Washington schlug vor, Moskau stimmte zu – und Trump blockierte ihn»